Originaltitel
Here
Deutscher Titel
Here
Produktionsland
USA
Filmdauer
104 min
Produktionsjahr
2024
Produzent*in
Block, Bill / Golov, Andrew / Zemeckis, Robert
Regie
Zemeckis, Robert
Verleih
DCM Film Distribution GmbH
Starttermin
12.12.2024
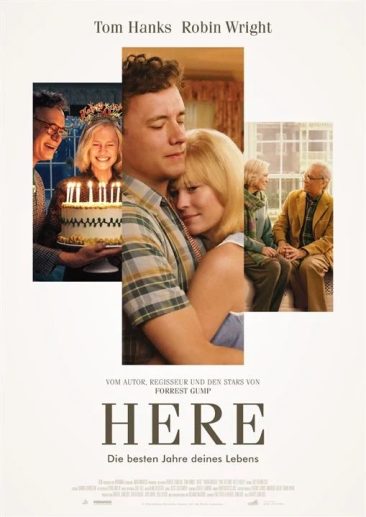
Here
Here
USA
104 min
2024
Block, Bill / Golov, Andrew / Zemeckis, Robert
Zemeckis, Robert
DCM Film Distribution GmbH
12.12.2024
Wöchentlicher Newsletter mit den aktuellen Arthouse-Charts und neuesten Beiträgen.
