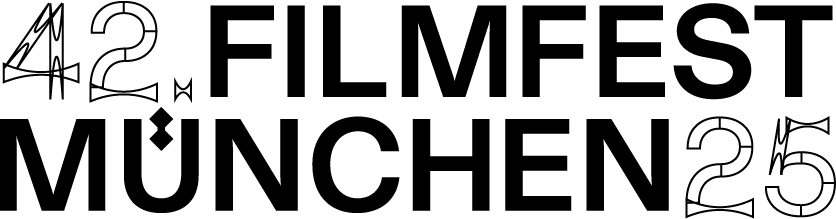Der gefeierte südkoreanische Regisseur Kim Ki-Duk verbindet in seinem 16. Film ein extrem persönliches Selbstporträt über die Gründe seiner Depression und der damit verbundenen Schaffenskrise mit einer filmisch faszinierenden Antwort. „Arirang“ ist ein spannendes biographisches Dokument und in seiner hemmungslosen Offenheit ein erstaunliches Kino-Ereignis. Arirang erhielt 2011 auf den Filmfestspielen von Cannes gemeinsam mit Andreas Dresens Halt auf freier Strecke den Prix Un Certain Regard.
Webseite: www.rapideyemovies.de
Südkorea 2011
Regie: KIM Ki-duk
Darsteller: KIM Ki-duk
Länge: 100 Min. OmU
Verleih: Rapid Eyes Movies
Kinostart: 26. Januar 2012
PRESSESTIMMEN:
…
FILMKRITIK:
Der 1960 geborene Süd-Koreaner Kim Ki-Duk realisierte seit seinem Debüt „Crocodile“ 1996 in 13 Jahren unglaubliche 15 Filme. Bei seinem letzten, „Dream“, wäre eine Schauspielerin bei einer Selbstmordszene fast tatsächlich gestorben, hätte sie der Regisseur nicht im letzten Moment aus der Schlinge um ihren Hals befreit. Dieses Ereignis traumatisierte ihn. Auf den Festivals bemerkte man das Fehlen neuer Filme von ihm. Die entstandenen Gerüchte erhielten mit seiner Wiederkehr nach drei Jahren bei Cannes 2011 eine überraschende und bewegende Antwort: „Arirang“ zeigt Kim Ki-Duk zurückgezogen in einer Hütte und in der Hütte ein Zelt, damit er ohne vernünftige Heizung unter winterlichen Bedingungen überleben kann. Es ist ein extrem zurückgezogenes Leben, bei dem sich der Regisseur selbst, völlig ohne Team, aufnimmt.
„Ich kann gerade keine Filme machen. Also filme ich mich selbst.“ Er filmt sich beim Essen machen, beim Heizen, beim unermüdlichen Bau einer selbst entwickelten Expresso-Maschine. Und – dies ist ein Kunstwerk, kein banales Filmtagebuch – auf einer nächsten Ebene, reflektierend vor seinen eigenen Aufnahmen, im Selbstgespräch mit sich auf den Bildschirmen. Denn obwohl die Lebens- mehr als die Schaffenskrise zutiefst erschreckend wirkt, „Arirang“ ist auch immer wieder komisch. So dass der Gedanke nicht ausbleibt, dies alles könnte vorgespiegelt sein. Aber er verfliegt auch schnell wieder, spätestens wenn dieser Mann, der die Schründe an seinen Fersen in Großaufnahme zeigt, hemmungslos vor der Kamera weint. Nicht weint, heult, jammert, schreit, bis sein Schmerz einem ins Mark fährt. Der stark besoffene Gesang des titelgebenden koreanischen Schmachtliedes Arirang bleibt nach dem Film unauslöschlich im Gedächtnis.
Dass Kim Ki-Duk im Schnitt den selbst auferlegten Sisyphos-Gang des jungen Mönches aus „Frühling, Sommer, Herbst, Winter… und Frühling“ mit seinem eigenen Leidensweg verbindet, führt zu einer gewaltigen, ganz großen und tief bewegenden Szene. Bitter und wieder so glaubwürdig, dass man fast die Polizei rufen möchte, sind eingestreute Spielszenen, wie er sich an verräterischen Mitarbeitern rächt, die ihm ein Drehbuch geklaut haben. Mit einer selbst gebauten Pistole, wohlgemerkt. Wie gesagt, „Arirang“ ist nicht das auf digitalen Datenträger gespeicherte Selbstmitleid eines Depressiven, es ist – ausgehend von ganz banalen Beobachtungen – ein großes Werk! Wer den zurückgezogenen Koreaner bei der Premiere in Cannes erlebte, kann ihm nur wünschen, dass er bald wieder einen neuen Film macht. Nicht für das Weltkino sondern für sich selbst.
Fellini hatte sein „8 1/2“. Kim Ki-Duk mit „Arirang“ sein „15 1/2“. Nicht nur die Frequenz, mit der die Meisterwerke des gefeierten Süd-Koreaners nach „Frühling, Sommer, Herbst, Winter… und Frühling“ auf die internationalen Festivals kamen, unterscheidet sich von der Epoche Fellinis. Auch die Art des Filmemachens hat sich geändert. „Arirang“ ist extrem persönlich und trotzdem als Kunstwerk geformt. Ein radikales Eingeständnis der eigenen Depression und der Weg über einfachstes Handwerk zurück zum Film.
Günter H. Jekubzik
Der koreanische Filmregisseur KIM Ki-duk ist ein bekannter Mann. In 13 Jahren drehte er 15 Filme; alt ist er noch keineswegs. Er hat hohe Preise gewonnen, in Cannes beispielsweise und in Venedig. KIM Ki-duk: „eine schöne und doch grausame, spannende und doch anstrengende, traurige und doch süße Zeit des filmischen Schöpfungsprozesses . . . „
Im Jahre 2008 drehte er dann den Film „Dream“, und dabei passierte ein schwerer Unfall, der eine Darstellerin fast das Leben gekostet hätte.
Das schockte den Regisseur derart, dass er vermutlich in erster Linie deswegen seine Filmarbeit einstellte. Drei Jahre geht das jetzt schon so. Er lebt völlig zurückgezogen, hat sich in einer primitiven Hütte einquartiert, isst viel und trinkt noch mehr.
Vor allem scheint er nachzudenken: über den Sinn oder Unsinn seiner Arbeit; über seine früheren Mitarbeiter, die ihn verlassen haben; darüber, dass er vielleicht nie wieder filmen wird; über seinen depressiven Zustand; über seine derzeitige Unfähigkeit, überhaupt etwas zu tun; über die Fraglichkeit seiner Existenz; über den Sinn oder Unsinn des Lebens; über den Tod; und über viele andere Dinge mehr.
KIM Ki-duk ist ein sehr gescheiter Mensch; man wird bei dem von ihm Gesagten durchaus aufmerksam. Er konnte die Finger eben doch nicht vom Filmen lassen, also machte er einen Film gänzlich über sich selbst. Er ist sein eigener Darsteller und sein Gesprächspartner. Minutenlang redet er mit sich. Die Dialektik, die er dabei an den Tag legt, ist zum Teil ganz schön geschliffen.
Irgendwann konstruiert er einen Revolver, erschießt drei Menschen und tut dann so, als ob er sich selbst erschösse. Das ist ein Teil der „Bekenntnisse“, der erratisch wirkt und von der Qualität her abfällt.
Sowieso darf man KIM Ki-duk nicht gänzlich auf den Leim gehen. Es handelt sich um einen höchst interessanten Film; um einen Traktat, der vieles über einen Menschen (und die Menschheit) aussagt; um ein Produkt, das so ausgefallen ist wie vieles in seinen 15 Filmen; aber auch um ein Stück, in dem er ausdrücklich viel auf „Show“ macht.
KIM Ki-duks Selbst- und Schauportrait, formal ausgefallen, aber thematisch und dialektisch hochinteressant.
Thomas Engel