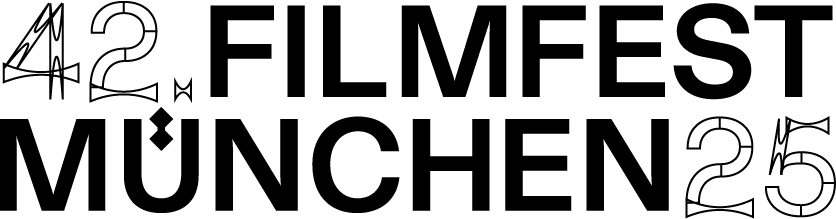In der an Skandalen wahrlich nicht armen Karriere des Klaus Kinski, hatte der 20. November 1971 – an dem die Rezitation eines von Kinski verfassten Textes durch Zwischenrufer und Störer verhindert wurde – stets einen besonderen Ruf. Kinski-Biograph Peter Geyer hat nun mittels Dokumentaraufnahmen den Abend nachgezeichnet und ein faszinierendes Zeitporträt geschaffen. Denn weniger Kinskis Text über seine Sicht auf den „wahren“ Jesus bleibt in Erinnerung, als die selbstgefälligen Auswüchse der Diskussions(un)kultur der Zeit.
Webseite: www.kinski.de
Deutschland 2008 – Dokumentation
Regie: Peter Geyer
84 Minuten
Verleih: Edition Salzgeber
Kinostart: 15.5. 2008
PRESSESTIMMEN:
…
FILMKRITIK:
Am 20. November 1971 gab bzw. versuchte Klaus Kinski in der Berliner Deutschlandhalle einen eigenen Text zu rezitieren. Die persönliche Sichtweise des Schauspielers auf Jesus Christus soll es werden, eine Abkehr vom „Kirchen-Jesus“, jener über die Jahrhunderte immer wieder veränderten Figur, der zum Zwecke des Machterhalts der Kirchen in die jeweils genehme Form gepresst wurde. Kinski beschwört einen Jesus, der zwar in vielem an die Jesus-Figuren der Evangelien erinnert, aber eben auch jede Form von organisierter Religion ablehnt. Es ist eine Art „Kinski-Evangelium“, vorgetragen mit enormer Intensität, Momenten der Wut über den Zustand der Welt Anfang der 70er Jahre. Ganz allein steht Kinski auf der kahlen Bühne in einem Scheinwerferkegel. Mit langen Haaren, Jeans und buntgeflecktem Hemd steht er da und beginnt mit einem fiktiven Steckbrief: „Gesucht wird Jesus Christus.“ Doch weit kommt er nicht. Schon nach wenigen Minuten, machen sich die ersten Zwischenrufer bemerkbar, die Kinski Scheinheiligkeit und Phrasendrescherei vorwerfen oder ihn einfach als „Krimischauspieler“ oder „Arschloch“ beschimpfen. Und wie man es von Kinski kennt, ja – und hier beginnt die Ambivalenz des Ganzen – eben auch irgendwie erwartet, bricht der Jähzorn schnell durch. Diesen Moment des ersten Abbruches kennt man aus Werner Herzogs Dokumentation „Mein Liebster Feind“. Ein Zuschauer kommt auf die Bühne und sagt, dass der historische Jesus wohl kaum einem anderen mit den Worten „Halts Maul“ das Wort verboten hätte. Woraufhin Kinski ihm mit der ihm eigenen unfassbar intensiv wirkenden Wut antwortet „Nein, er hätte eine Peitsche genommen und hätte ihm in die Fresse geschlagen.“
Dass ist zwar einerseits ein absurder, in seiner bizarren Wut angesichts eines zivilisiert vorgebrachten Einwandes auch amüsanter Moment, zeigt aber auch die Schwierigkeit Kinskis, der öffentlichen Person, die er über die Jahre aufgebaut hatte, mit der er berühmt und reich geworden war, zu entkommen. Für viele Zuschauer war Kinski eben der Berserker, der mit Tobsuchtsanfällen Regisseure und Kollegen in den Wahnsinn trieb und ebenso faszinierte wie abstieß. Den anderen Kinski, den Nachdenklichen, Reflektierten, Zärtlichen, der im Laufe seines Vortrages immer wieder Tränen vergoss, wollten die meisten Menschen nicht sehen. Und mit immer neuen Ausbrüchen, dem ständigen Abbruch und der Wiederaufnahme seines Vortrages, mit wütenden, aggressiven Beschimpfungen gab Kinski dem Affen Futter und bestätigte auf ungewollte Art den Vorwurf der Scheinheiligkeit. Wie ein Zuschauer bemerkt heißt es „Man soll ihn nicht an seinen Worten messen, sondern an seinen Taten.“ Und Kinskis Taten widersprechen seiner im Vortrag vertretenen friedlichen Haltung eben fundamental, egal ob dies durch bewusst provozierende Zwischenrufe hervorgerufen wurde oder nicht.
Ganz unbeabsichtigt ist Peter Geyers Film also auch ein Psychogramm Kinskis geworden, über das Zeitporträt hinaus. Dass allein hätte „Kinski – Jesus Christus Erlöser“ sehenswert gemacht, so aber wird ein Blick in die Sackgasse gewährt, in die sich Kinski manövriert hatte und aus der er auch den Rest seiner Karriere nie wirklich herauskommen sollte.
Der Abend des 20. Novembers allerdings endete versöhnlich. Spät in der Nacht, nachdem die Veranstaltung eigentlich endgültig abgebrochen schien, versammelten sich die verbleibenden Zuschauer, kaum 100 an der Zahl, vor der Bühne und lauschten den Worten Kinskis. Um zwei Uhr Morgens hatte er es endlich geschafft, seinen Vortrag zu beenden. In seiner Autobiographie, aus der Geyer einige Male auf eingeblendeten Texttafeln zitiert schreibt Kinski: „Meine Erschöpfung ist wie weggeweht. Ich fühle meinen Körper nicht mehr.“ Es ist einer jener anderen Momente in Kinskis Leben. Ein Moment von transzendentem Glück, so wie ihn auch Herzog ans Ende von „Mein liebster Feind“ stellt, wenn er Kinski zeigt, wie dieser mit kindlicher Freude beobachtet, wie ihn ein Schmetterling umschwirrt.
Michael Meyns