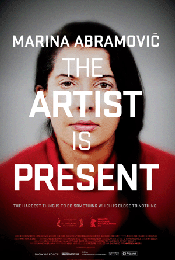2010 wurde der in Belgrad geborenen Performance Künstlerin Marina Abramovic eine seltene Ehre zuteil: Eine Retrospektive im New Yorker Museum of Modern Art. In den Monaten vor und während der Ausstellung begleitete Matthew Akers die Künstlerin und zeichnet in seiner Dokumentation ihr Leben nach. Ein spannender Einblick in ein faszinierendes Werk.
Webseite: www.nfp.de
USA 2011 – Dokumentation
Regie: Matthew Akers
Länge: 106 Minuten
Verleih: NFP
Kinostart: 29. November 2012
PRESSESTIMMEN:
…eine beeindruckende Doku. …das intime Porträt einer Grenzgängerin, die ihr Leben und ihren Körper ganz in den Dienst der Kunst gestellt hat – eine echte Wonder-Woman.
STERN
FILMKRITIK:
Drei Monate lang, von morgens bis abends still auf einem Holzstuhl sitzen, ständig wechselnden Gegenübern in die Augen sehen, umringt von tausenden Schaulustigen. Diese Performance stand im Mittelpunkt der großen Retrospektive, mit der 2010 die serbische Performance Künstlerin Marina Abramovic im New Yorker Museum of Modern Art geehrt wurde. Und auch Regisseur Matthew Akers stellt sie in den Mittelpunkt der zweiten Hälfte seiner Dokumentation „Marina Abramovic: The Artist is Present“, die im Panorama der diesjährigen Berlinale mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde. Praktisch unbegrenzten Zugang hatte Akers zu der einen Tag nach Filmstart 65 Jahre alt werdenden Künstlerin, eine Nähe, die den Film zu einer Hommage macht.
In groben Zügen zeichnet Akers Abramovics Kindheit in Belgrad nach, ihre ersten Performances und schließlich ihren Umzug nach Amsterdam. Dort lernt sie 1976 den deutschen Künstler Uwe Laysiepen kennen, der sich Ulay nennt. Sie wurden ein Paar, im Leben und der Kunst. Es war die große Zeit der Performancekunst, als Nacktheit noch schockieren konnte, kleinste Formen der Selbstentblößung oder gar Selbstverletzung skandalisiert wurden. 1988 trennte sich das Paar, natürlich nicht einfach so, sondern auf spektakuläre Weise nach einer letzten gemeinsamen Performance: Von unterschiedlichen Enden schritten sie die Große Mauer in China ab, trafen sich in der Mitte und verabschiedeten sich.
Auch Ulay kommt im Film zu Wort, neben Kuratoren, Freunden von Abramovic und vielfältigen Bewunderern. Doch es sind die Momente mit Ulay, die zu den berührendsten des Films gehören. Ein Wiedersehen nach langer Zeit, später auch ein Gegenübersitzen während Abramovics Performance im MoMa, die andeuten, wie tief die Zuneigung der beiden Künstler einst gewesen sein muss, die die oft aggressiven, selbstentblößenden Performances erst ermöglichte.
Man könnte Akers vorwerfen, dass er nicht versucht, Abramovics Arbeit genauer zu analysieren, zu hinterfragen – auch kritisch – wo ihre Intentionen liegen, wie sich ihre Kunst im Laufe der Jahre verändert hat. Die Beschreibungen von Journalisten und Kuratoren bleiben diesbezüglich eher oberflächlich, beschreiben das Offensichtliche, die Ruhe, die Abramovic ausstrahlt, ihre Offenheit, das Partizipative ihrer Performances. Dass inzwischen durchaus zweischneidig ist: Als sich bei der „Sitzperformance“ eine Frau ihr Kleid über den Kopf zieht, um Abramovic nackt gegenüber zu sitzen, wird sie schnell von Sicherheitskräften abgeführt. Unter Tränen sagt die Frau „Ich dachte die Zuschauer seien Teil der Performance!“ Nun, offenbar nur bis zu einem bestimmten Grad. Wie sehr Abramovic inzwischen zum Medienstar geworden ist zeigt die Existenz dieser Dokumentation, aber auch Besuche von Hollywoodgrößen wie Jeff Franco oder Orlando Bloom, die sich während der MoMa-Schau blicken ließen.
Doch diese Popularität, die 750.000 Besucher ihrer Ausstellung, die langen Schlangen, kann man Abramovic schwerlich vorwerfen. Während Akers seine Begeisterung für sein Objekt kaum verhehlen kann, bleibt Abramomic selbst zurückhaltend, bescheiden. Sie strahlt in jedem Moment die innere Ruhe aus, die es ihr überhaupt erst ermöglicht, drei Monate lang stundenlang auf einem Stuhl zu sitzen. Die tieferen Beweggründe ihrer Arbeit hat zwar auch diese Dokumentation nur angedeutet, einen spannenden Einblick in das Leben einer faszinierenden Frau ist Matthew Akers „Marina Abramovic: The Artist is Present“ in jedem Fall.
Michael Meyns
Ist die „Performance“ eine Kunstgattung? Sie ist nur im Augenblick mitzuerleben, ist vergänglich, wird meist nur einem kleinen Kreis von Zuschauern zuteil.
Man möchte die Frage jedoch mit ja beantworten, wenn man diesen Film gesehen hat. Er schildert Wirken und Leben der serbischstämmigen Performance-Künstlerin Marina Abramovic, einer exotisch-originellen, geistig regen, spürbar reif gewordenen Frau. Jahre-, ja jahrzehntelang vollbrachte sie zum Teil subversive, provozierende Performances – bis 2010 der Höhepunkt ihres künstlerischen Lebens kam: eine dreimonatige Ausstellung im New Yorker Museum of Modern Art.
Schauspieler stellten dabei frühere Abramovic-Performances nach. Sie selbst trug den „The Artist Is Present“-Teil dazu bei, indem sie drei Monate lang jeden Tag siebeneinhalb Stunden regungslos auf einem Stuhl verharrte. Doch nicht nur das. Ihr gegenüber befand sich ein zweiter Stuhl, auf dem Ausstellungsbesucher Platz nehmen und wortlos mit ihr kommunizieren konnten. Hochemotionale Szenen spielten sich dabei ab. Viele kamen mehrere Male, es flossen Tränen, vielsagende Blicke wurden ausgetauscht.
Die „Entschleunigung“ des Zeitbegriffs, vielfältig zu deutende Beziehungen, Bewusstseinsveränderungen spielten dabei eine Rolle. Sehr präzise zu definieren ist das letztlich nicht. Dem starken Eindruck, den der Film hinterlässt, tut das aber keinen Abbruch.
Auch die den Vorgang kommentierenden Partner, Freunde, Fachleute und Veranstalter waren zum großen Teil auf Hypothesen angewiesen. Sicher ist, das Abramovic selbst dem Ziel, die Performance zur Kunst zu erheben, näher gekommen ist. (Insgesamt nahmen nicht weniger als 750 000 Besucher an der Ausstellung teil. Ein voller Erfolg also.)
Ein sicher nicht leicht zustande zu bringendes, geschickt montiertes insgesamt beachtliches Filmstück. Es wirft ebenso ein Licht auf den Werdegang und die Reifung der Künstlerin und ihrer Kunst wie auf die Masse der Besucher, unter denen weder die echt Teilnehmenden fehlten noch die bloßen Gaffer.
Sich anhand von „The Artist Is Present“ Gedanken zu machen über den Zeitbegriff, über die Kunst, über deren Wirkung auf die Menschen und ihr Verhalten – kann sich lohnen.
Thomas Engel