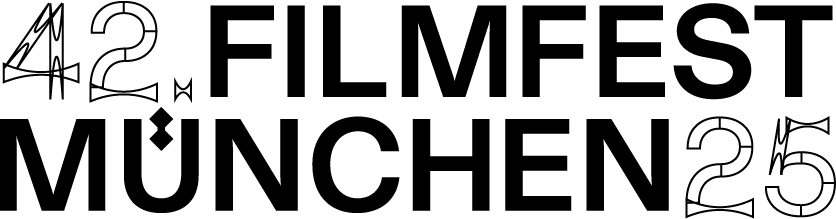Eine junge japanische Frau reist nach Deutschland, ins Allgäu, auf den Spuren ihrer Vergangenheit. Die ist in Marie Miyayamas Regiedebüt treibende Kraft der Figuren, verstärkt durch ein überdeterminiertes Drehbuch, dass den Charakteren wenig Luft zur Entfaltung lässt. In dieser Hinsicht ist die deutsch-japanische Co-Produktion sehr deutsch, andere Aspekte – besonders die Musik – sind wiederum ebenso „typisch“ japanisch. Ein Debütfilm, dem man das Bemühen um Bedeutung allzu sehr anmerkt.
Webseite: www.derrotepunkt-derfilm.de
Deutschland/Japan 2008
Regie: Marie Miyayama
Buch: Marie Miyayama, Christoph Tomkewitsch
Kamera: Oliver Sachs
Schnitt: Marie Miyayama
Musik: Helmut Sinz
Darsteller: Yuki Inomata, Hans Kremer, Orlando Klaus, Imke Büchel, Zora Thissen, Mikito Otonashi, Xhinya Owada
Länge: 82 Minuten, Format: 1:2,35 (Scope)
Verleih: Movienet Film
Kinostart: 4. Juni 2009
PRESSESTIMMEN:
Dass aber auch ernsthafte Themen bewegend in Szene gesetzt werden können, das zeigte in diesem Jahr in Hof die junge Absolventin der HFF München Marie Miyayama mit ihrem Erstling DER ROTE PUNKT, der auch den Förderpreis Deutscher Film völlig zu Recht gewann… Ein traumhaft bewegender Film…
Festivalbericht 42. Hofer Filmtage 2008 von Kalle Somnitz und Anne Wotschke auf Programmkino.de hier…
FILMKRITIK:
Dass Aki Onodera (Yuki Inomata) in Tokio Deutsche Literatur und Sprache studiert, ist doppelt ironisch. Ihre besondere, schicksalhafte Verbindung zu Deutschland ist treibendes Element der Geschichte, deren wichtigstes Thema ausgerechnet die Sprachlosigkeit ist. Von ihrer Tante und ihrem Onkel, bei denen Aki aufgewachsen ist, hat Aki nie Antworten auf die Fragen bekommen, die bislang unbewusst ihr Leben beeinflusst haben. Erst als sie bei einem Besuch zu Hause ein Paket bekommt, das lange Jahre in einem Schrank auf ihr Erwachsenwerden wartete, beginnt Aki diese Fragen auszusprechen. In dem Paket findet sie neben einer Karte und einigen Souvenirs aus Deutschland auch eine alte Kamera. Auf den Fotos sieht man eine junge Familie, Eltern und zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen: Aki. Inzwischen ist aus dem kleinen Mädchen auf dem Foto eine junge Frau geworden, die sich nun auf die Suche nach ihrer Vergangenheit macht. Sie sucht den roten Punkt auf der Landkarte, der sich irgendwo im Allgäu befindet. Dort angekommen begegnet sie schnell der Familie Wagner, Vater, Mutter, zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter, mit der sie mehr verbindet, als Aki zunächst realisiert.
Womit Aki leider alleine steht, denn als Zuschauer ist das Konstrukt, dass die aus Japan stammende, in Deutschland arbeitende Regisseurin Marie Miyayama hier entwirft, allzu leicht zu durchschauen. Zu offensichtlich sind die Dopplungen in der Familienkonstruktion, zu deutlich die auffälligen Verhaltensweisen der deutschen Familie. Zwischen Vater und Sohn findet keine Kommunikation statt, der Sohn überkompensiert seine Probleme mit dem Rasen auf seinem Motorrad, der Vater zeigt übertriebenes Interesse an der Japanerin, die ihn augenscheinlich an die Vergangenheit erinnert.
Gefilmt ist das in ruhigen Breitwandbildern, die sich ebenso um Kontemplation bemühen wie die minimalistische Musik, die einzelne, lang gezogene Klavierklänge nebeneinander stellt, geradeso, wie man das aus thematisch ähnlichen japanischen Filmen kennt.
Woran sich Miyayama leider nicht orientiert hat, ist das subtile, fast Beiläufige, mit der asiatische Regisseure vom Schicksal ihrer Figuren erzählen. Auch diese sind oft von Ereignissen in der Vergangenheit geprägt, doch auf unterschwellige Weise. Die Determiniertheit, mit der Miyayama und ihr Coautor Christoph Tomkewitsch hier vorgehen, zwängt ihre Figuren dagegen in ein Konstrukt, in dem es keinerlei Raum für Kontemplation gibt. Das Drehbuch zwingt die Figuren in eine Geschichte, die dann wenig überraschend abgespult wird. Aki kommt mit ihrer Vergangenheit ins Reine und auch die deutsche Familie befindet sich auf dem Weg der Besserung.
Letztlich ist es diese Finalität der Ereignisse, die Suggestion, dass mit Erkennen und Verarbeiten eines einschneidenden Ereignisses aus der Vergangenheit praktisch alle Hindernisse aus dem Weg geräumt sind, die den Film aus der angestrebten interkulturellen Schwebe lösen, und zu einem dezidiert westlichen Film machen. Dass ist nicht schlimm, erfüllt aber nicht das Versprechen, dass Film und Regie in den ersten Minuten von „Der rote Punkt“ gemacht hatten.
Michael Meyns
Die Japanerin Aki hat früh ihre Eltern und ihren kleinen Bruder verloren. Die Familie war damals, 1990, auf einer Urlaubsreise in Deutschland. Schloss Neuschwanstein stand auf dem Programm – wie bei allen Japanern.
Dann ein schlimmer Autounfall. Nur Aki blieb am Leben. Sie wurde bei einer Tante und deren Mann groß, die beiden waren ihre zweiten Eltern. Derzeit ist Aki auf Jobsuche. Sie sieht per Zufall ein Paket, das damals mit den Habseligkeiten der Toten aus Deutschland zurückgeschickt wurde.
Aki ist nicht mehr zu halten. Sie will ins Allgäu, an den Ort, an dem ihre Familie den Tod fand.
Angekommen, findet sie nicht gleich eine Unterkunft. Glücklicherweise wird sie von den Webers aufgenommen, von Elias, dem Sohn, Martina, der Tochter, Johannes, dem Vater, Erika, der Mutter.
Aki will nichts anderes als den Platz finden, an dem das Unglück geschah, den Gedenkstein, der an ihre Lieben erinnert. Sie sucht, sie sucht lange, sie sucht mehrere Male. Und sie findet den Ort. Schweigsam, in sich gekehrt, tief traurig, in der Stille mit den ihren sich austauschend verharrt sie dort mehrere Male.
Aber sie wird durch ihre Bleibe auch unmittelbar in das gespannte Verhältnis mit einbezogen, das bei den Webers herrscht: vor allem in die fast feindselige Beziehung zwischen dem aufmüpfigen 18jährigen Elias und dem Vater Johannes, der verklemmt wirkt und den Eindruck macht, er habe etwas zu verbergen.
Und so ist es denn auch: Johannes Weber hat mit dem Tode von Akis Vater, Mutter und Bruder zu tun.
Dem Film liegt entfernt ein solcher Vorfall zugrunde. Deshalb weist er auch dokumentarisch-authentische Bezüge auf. Ansonsten ist Akis Schicksal und Befindlichkeit mit dem Leben und der Problematik der Webers, vor allem des Vaters, gut verwoben – was auch in einer geschickten Montage zum Ausdruck kommt.
Still, getragen, einfühlsam, melancholisch ist dieser Film geworden – durch die aufkommende Freundschaft zwischen den Protagonisten auch ein wenig leichter und hoffnungsvoller. Bemerkenswert die gute Kamera, unterstützt natürlich von der schönen Allgäu-Landschaft. Bemerkenswert das subtile, ganz das frühere tragische Geschehen spürbar machende Spiel der Japanerin Yuki Inomata, die die Aki spielt. Auch die übrigen Darsteller (Hans Kremer als Johannes, Orlando Klaus als Elias, Imke Büchel als Erika und Zora Thiessen als Martina) gaben ihr Bestes.
Thomas Engel