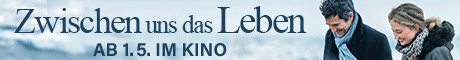Viel wurde während Donald Trumps Präsidentschaft über dessen Versuch geschrieben, Einwanderung zu stoppen und Migranten zu deportieren. Wie Justin Chons mitfühlendes, wenn auch bisweilen emotional überbordendes Drama „Blue Bayou“ zeigt, war diese Politik jedoch keine Spezialität Trumps, sondern besteht seit Jahren, mit oft haarsträubenden Folgen.
Website: https://www.upig.de/
USA 2021
Regie & Buch: Justin Chon
Darsteller: Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O’Brien, Linh Dan Pham, Sydney Kowalske, Vondie Curtis-Hall, Emory Cohen
Länge: 119 Minuten
Verleih: Universal
Kinostart: 10.3.2022
FILMKRITIK:
Ausweisungen sind das schärfste Mittel, das eine Demokratie verwenden kann, um straffällig gewordene Migranten in die Schranken zu weisen. Doch was, wenn die Migration in jungen Jahren, vielleicht sogar als Kind erfolgte, eine Person kaum oder sogar gar keine Erinnerungen mehr an das Land hat, aus dem er oder sie einst migrierte? Auch in Deutschland gibt es gelegentlich Fälle, in denen Familien nach Jahren des Aufenthalts in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, selbst wenn sie sich in Deutschland ein neues Leben aufgebaut haben, ihre Kinder oft gar kein anderes Leben kennen als das in Deutschland.
Noch häufiger kommen solche Fälle in dem immer noch beliebtesten Einwanderungsland der Welt, den Vereinigten Staaten von Amerika vor, wo angesichts zunehmender wirtschaftlicher Probleme eine erhebliche Zahl der Bevölkerung Migranten mit Skepsis betrachtet. Und das nicht nur auf der eher rechten Seite des politischen Spektrums, sondern generell. Nicht nur unter dem Repuplikanischen Präsidenten Trump, sondern auch unter seinem Demokratischen Vorgänger Barack Obama und dem Nachfolger Joe Biden verfolgen die USA eine teilweise bizarr anmutende Migrationspolitik.
Ein besonders krasses Beispiel ist die Vorlage für „Blue Bayou“, einen Film des koreanisch-amerikanischen Schauspielers Justin Chon, der seit einigen Jahren auch als Drehbuchautor und Regisseur aktiv ist. Aus den Erfahrungen etlicher Personen destillierte Chon die Geschichte seines Dramas, in dem er selbst die Hauptrolle Antonio LeBlanc spielt. Als dreijähriger wurde Antonio aus Korea von einem weißen, amerikanischen Paar adoptiert, dessen Nachname er annahm. Doch von Glück war sein Leben lange nicht geprägt, diverse Pflegefamilien durchlebte Antonio, wurde geschlagen, war wegen kleinerer Diebstähle im Gefängnis und hat nur langsam seinen Platz im Leben und in New Orleans eine Heimat gefunden.
Inzwischen ist er mit der Physiotherapeutin Kathy (Alicia Vikander) verheiratet, für deren kleine Tochter Jessie (Sydney Kowalske) er wie ein Vater ist. Der echte Vater ist der Polizist Ace (Mark O’Brien), der seiner Ex das neue Glück missgönnt und die tragischen Ereignisse in Gang setzt: Ein Streit mit Antonio eskaliert, dieser wird verhaftet und sieht sich auf einmal mit einer drohenden Deportation konfrontiert. Denn seine einstigen Pflegeeltern hatten es versäumt, die richtigen Anträge auszufüllen, die Antonio zu einem wirklichen Amerikaner gemacht hätten. Und auch wenn Antonio seit 30 Jahren in Amerika lebt, nur vage Erinnerungen an sein Geburtsland Korea hat, soll er nun auf Grund einer Lücke im Gesetz als krimineller Ausländer des Landes verwiesen werden. Eine haarsträubende Ungerechtigkeit, selbst wenn man berücksichtigt, dass Antonio nicht immer ein gesetzestreuer Bürger war.
Auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, der nicht nur Einzelfälle betrifft, sondern tatsächlich zehntausende aus dem Ausland adoptierte Menschen, ist der größte Verdienst von „Blue Bayou.“ Dass sich Justin Chon nicht auf die offensichtliche Ungerechtigkeit der Geschichte verlässt, sondern oft stark auf die Tränendrüse drückt ist dagegen bedauerlich. Weniger wäre hier mehr gewesen, das Drama aus den Figuren und ihrem Schicksal zu entwickeln hätte gereicht, mit Musik und filmischen Mitteln nachzuhelfen, gar nicht nötig.
Michael Meyns