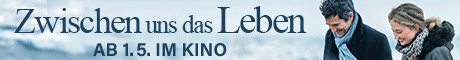Zum Vergrößern klicken
Zwischen Dokumentation und Fiktion siedelt Bastian Günther seinen Film "California City" an, in dem er die Themen seines letzten Films "Houston" fortführt: Der Verfall des Kapitalismus, wirtschaftliche Schwäche, die zu sozialem Niedergang führen, gepaart mit einer Nostalgie für ein Amerika, das längst nicht mehr dem American Dream entspricht.
Webseite: www.realfictionfilme.de
Deutschland 2014
Regie, Buch: Bastian Günther
Essayfilm
Länge: 90 Minuten
Verleih: Real Fiction
Kinostart: 9. Juli 2015
FILMKRITIK:
Mitten in der kalifornischen Mojave-Wüste liegt eine der flächenmäßig größten Städte Amerikas: California City, ein Name, der viel verspricht, aber inzwischen kaum mehr als Hohn ist. Weite Teile der Stadt sind verfallen, die Häuser verlassen, Bürogebäude leerstehend, die Swimming Pools ohne Wasser und verdreckt. Durch dieses Niemandsland bewegt sich ein namenloser Mann, der die Region vor einer drohenden Insektenplage bewahren soll, die Infektionskrankheiten mit sich bringt, wie man sie eher aus Entwicklungsländern kennt. Die Natur holt sich die Häuser zurück, die Wüste greift langsam wieder um sich, die Menschen irren einsam durch das Nichts und kämpfen gegen das unausweichliche Ende der westlichen Zivilisation, wie wir sie kennen.
In der Realität siedelt Bastian Günther eine postapokalyptische Fiktion an, die er fast ausschließlich über einen melancholischen, nostalgischen Voice Over Kommentar evoziert. Denn während dieser Kommentar reine Fiktion ist, bewegt sich seine Hauptfigur (gespielt vom Schauspieler Jay Lewis) durch die Realität, begegnet echten Menschen, die echte Leben führen. Wenn auch keine ganz gewöhnlichen: Auf einem Schrottplatz begegnet man da etwa einem Mann, der in mühsamer Handarbeit Autos und anderen Schrott ausweidet, um mit dem Verkauf von Altmetall ein wenig Geld zu verdienen. Oder ein Mann, der auf einem Flugzeugfriedhof ein Bewerbungsvideo für eine Reise zum Mars dreht. Zwischendurch telefoniert der Namenlose mit einer Art spiritueller Telefonseelsorge, die ihm Halt in seinem zunehmend isolierten Dasein verleiht. Arbeit gibt es kaum noch, der Kontakt zu seinen Vorgesetzten bricht ab und die Erinnerung an seine Freundin Chelsea lässt ihn nicht los.
Schon in seinem letzten Film, dem eindeutigen Spielfilm "Houston", ließ sich Bastian Günther von den Mythen Amerikas leiten, die längst der grauen Realität zum Opfer gefallen sind. In den gläsernen Hochhausschluchten der Großstadt Houston inszenierte er den Verfall eines Mannes, der Job und Familie verliert. "California City" ist nun eine Variation, aber auch eine Weiterentwicklung dieses Sujets, der diesmal nicht nur die Faszination für Amerika, seine Geschichten und Mythen, wie sie besonders Wim Wenders im deutschen Kino zeigte, verwendet, sondern auch viel von Werner Herzog hat. Dieser bediente sich immer wieder fiktiven Stilmitteln, um die dokumentarisch aufgezeichnete Realität zu überhöhen und im besten Fall noch wahrhaftiger zu machen.
Bastian Günther ist fraglos mehr dem Fiktiven verhaftet, benutzt einen Schauspieler, der echten Menschen begegnet, von denen man natürlich auch nicht genau wissen kann, wie echt sie tatsächlich sind. Vor allem sind es somit die Orte, die verfallenen Häuser, die unmittelbar auf eine gesellschaftliche Realität verweisen, die zunehmend vom Verfall geprägt ist. Manchmal droht er sich dabei im nostalgischen Mäandern zu verlieren, doch oft ist es gerade die ungewöhnliche Form, das Spiel mit Realität und Fiktion, die "California City" seine besondere Qualität verleihen, die zu hellsichtigen Reflektionen über den Verfall der Zivilisation führen.
Michael Meyns