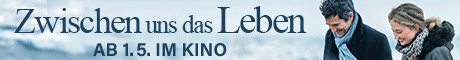Regisseurin und Autorin Sarah Blaßkiewitz erzählt in ihrem neuen Film IVIE WIE IVIE von einer jungen, afroamerikanischen Frau, die gar nicht einsieht, als Deutsche mit ausländischen Wurzeln Integrationsvorbild zu sein. Doch als sie ihre bislang unbekannte Halbschwester kennenlernt, bekommt sie die Welt um sich herum plötzlich aus einer anderen Perspektive präsentiert. Ein starker, wirklich sehr beeindruckender Film über Selbstbestimmung.
Website: http://weydemannbros.com/filme/iviewieivie
DE 2021
Regie: Sarah Blaßkiewitz
Darsteller:innen: Haley Louise Jones, Anneke Kim Sarnau, Max Riemelt, Fabian Stumm, Lorna Ishema, Anne Haug, Tina Pfurr
Verleih: Weydemann Bros. Milena Klemke
Länge 112 Min.
Start: 16.9.2021
FILMKRITIK:
Die Lehrkraftanwärterin Ivie (Haley Louise Jones) führt ein ganz normales Großstadtleben. Nur hin und wieder wird die selbstbewusste Afroamerikanerin daran erinnert, dass ihr einzig und allein aufgrund ihrer Hautfarbe Steine in den Weg gelegt werden. Häufig wird ihre Herkunft zum Bestandteil von Bewerbungsgesprächen. Und dass ihre beste Freundin sie seit 25 Jahren mit dem Spitznamen „Schoko“ anspricht, ist für Ivie zwar selbstverständlich, doch ausgerechnet Ivies plötzlich auftauchende Halbschwester Naomi (Lorna Ishema) empfindet dies als Blauäugigkeit gegenüber offen ausgelebtem, „positivem“ Rassismus. Doch eigentlich ist Naomi aus einem ganz anderen Grund bei Ivie aufgetaucht: Ihr gemeinsamer Vater, den Ivie nie gekannt hat, ist tot. Und Naomi hat vor, gemeinsam mit ihrer Halbschwester nach Afrika zu reisen, um von ihm Abschied zu nehmen. Ivie hat auf diese Reise zwar so gar keine Lust, doch je länger Naomi bei ihr bleibt, desto mehr lernt die junge Frau, ihr Umfeld kritischer zu betrachten und sich nicht länger alles gefallen zu lassen…
Regisseurin und Drehbuchautorin Sarah Blaßkiewitz nimmt sich mit ihrem zweiten Langspielfilm nach „Blank“ (2016) eines Themas an, das es gefühlt zuletzt allzu häufig in den Kinos oder im Fernsehen zu sehen gab. Die Gesellschaft durchlebt dieser Tage eine immense Sensibilisierung gegenüber strukturiertem Rassismus. Und selbst wenn es für viele noch neu ist, über lange Zeit verinnerlichte Angewohnheiten abzulegen, so ist das Thema mittlerweile derart allgegenwertig, dass wir über Kurz oder Lang eigentlich gar nicht anders können, als dazuzulernen. Trotzdem ist Blaßkiewitz‘ Film anders. Es ist keiner dieser typisch-deutschen „Problemfilme“, die ein Rassismusschicksal ausleuchten und dabei kleinteilig die Missstände analysieren, um anschließend mit großen Gesten die Schuldigen (ergo: Befürworter aktueller Missstände) an den Pranger zu stellen. Auch gegen derart deutliche, dadurch quasi unübersehbare Filmbotschaften gibt es nichts auszusetzen. Doch die Subtilität, mit der in „Ivie wie Ivie“ dasselbe Thema verhandelt wird, verleiht der Grundaussage viel mehr Nachdruck.
Das beginnt schon bei der von Haley Louise Jones („Professor T.“) selbstbewusst verkörperten Protagonistin Ivie. Die betont nicht nur immer wieder, Deutsche zu sein und mit „ihrer“ – bzw. der ihr angedichteten – afrikanischen Kultur überhaupt nichts mehr am Hut zu haben (ein sich wiederholender Dialog im Film: „Woher kommen Sie?“ „Aus Leipzig!“), sondern zeigt sich bisweilen regelrecht abgestoßen von der Idee, als „Vermittlerin zwischen den Kulturen“ zu agieren, wie sie es im Bewerbungsgespräch mit Schulleiterinnen und -Schulleitern immer wieder vorgebetet bekommt. Ganz so, als sei ihre hervorragende Ausbildung nur nebensächlich und die Hautfarbe ein alleiniges Einstellkriterium. Ivie lächelt über solche Fragen hinweg. Manchmal mit strengerer Miene als sonst. Ganz so, als würde sie solche Äußerungen ihrer Gegenüber bisweilen sogar verstehen, bis es selbst ihr zu bunt wird.
Eine Szene der Eskalation – ein Moment, in dem ein sprichwörtlicher Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt – gibt es auch. Und sie entwickelt sich homogen aus sämtlichen kleinen, davor herausgearbeiteten Beobachtungen, die Ivie während ihres Alltags sammelt. Ihre beste Freundin nennt sie seit 25 Jahren „Schoko“? Für Ivie völlig fein, schließlich entwickeln sich Spitznamen ja sehr oft aus äußerlichen Merkmalen heraus. Auch dass dieselbe Freundin ihr vor einem beruflichen Termin den Tipp gibt, ihre Haare mehr zu betonen, um „Stolz auf ihre Herkunft“ zu sein, lächelt Ivie weg, gibt aber im selben Atemzug zu verstehen, dass sie ihrer Herkunft gegenüber eher eine Gleichgültigkeit empfindet.
Blaßkiewitz geht es in „Ivie wie Ivie“ weder darum, das Schicksal eines Opfers, genauso wenig aber über die „Täter“ zu erzählen. Stattdessen handelt ihr Film von Rollenmustern, in die wir jeden in unserem Umfeld unbewusst zwängen, respektive gezwängt werden. Vor allem aber klopft die Autorenfilmerin Erwartungen an all jene ab, die sich in unserer Gesellschaft einer Minderheit zuordnen können – und macht sie frei davon, irgendeine „Aufgabe“ erfüllen zu müssen. Sei es nun die des Sündenbocks, des Vorbilds, der Identifikationsfigur und so weiter und so fort. Das ist für einen Film dieser Thematik ein regelrechtes Understatement und gerade dadurch umso näher an der Lebensrealität sämtlicher im Film abgebildeter Menschen und Gesellschaftsschichten. Da passt es auch, dass der Subplot rund um Ivies und Naomies Vater allzu schnell in den Hintergrund rückt und sich die Figur der Naomie stattdessen als komplettes Gegenteil ihrer Halbschwester erweist. So gelingt es Blaßkiewitz letztlich noch besser, das Thema mannigfaltig zu beleuchten - und erlaubt sich in ihrem Film sogar, dass Minderheiten darüber uneins sein dürfen, was Rassismus ist und was nicht. Ein hervorragender Denkanstoß für sämtliche Zuschauer:innen!
Antje Wessels